
Wenn Sie dieses Emblem am Eingang eines Gartens entdecken, bedeutet dies, dass ihre Besitzer die Garten-Charta unterzeichnet haben. Sie haben damit die moralische Verpflichtung übernommen, ihr Grundstück so zu pflegen und auszustatten, dass wildlebende Kleintiere wie Vögel, Igel, Schmetterlinge, Eidechsen etc. besser überleben können.
Idealerweise wird die Garten-Charta lokal von einer Gemeinde, einer Quartiervereinigung oder einer Anwohnergruppe verwaltet. Man kann ihr aber auch individuell beitreten.
Warum eine solche Charta?
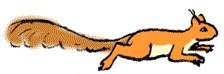 Lange Zeit war es für die sympathischen Besucher unserer Gärten wie Igel, Eichhörnchen, Vögel oder Schmetterlinge ein Leichtes, im Umkreis der Wohngebiete Nahrung und auch Plätze zu finden, wo sie ihren Nachwuchs aufziehen oder den Winter verbringen konnten. Aber die für die kleine Tierwelt günstigen Orte werden immer seltener, unter anderem weil die naturbelassenen Plätze zwischen den bewohnten und landwirtschaftlich genutzten Zonen unter dem Druck der Verstädterung seltener werden. Hinzu kommt, dass grössere Landflächen in kleinere, voneinander abgetrennte Parzellen aufgeteilt werden. Mit der Parzellierung verschwinden aber wilde Hecken, alte Bäumbestände, weniger oft gemähte Wiesen sowie Haufen aus Steinen und Ästen, die so wichtig für das Überleben und die Fortpflanzung dieser Tiere sind.
Lange Zeit war es für die sympathischen Besucher unserer Gärten wie Igel, Eichhörnchen, Vögel oder Schmetterlinge ein Leichtes, im Umkreis der Wohngebiete Nahrung und auch Plätze zu finden, wo sie ihren Nachwuchs aufziehen oder den Winter verbringen konnten. Aber die für die kleine Tierwelt günstigen Orte werden immer seltener, unter anderem weil die naturbelassenen Plätze zwischen den bewohnten und landwirtschaftlich genutzten Zonen unter dem Druck der Verstädterung seltener werden. Hinzu kommt, dass grössere Landflächen in kleinere, voneinander abgetrennte Parzellen aufgeteilt werden. Mit der Parzellierung verschwinden aber wilde Hecken, alte Bäumbestände, weniger oft gemähte Wiesen sowie Haufen aus Steinen und Ästen, die so wichtig für das Überleben und die Fortpflanzung dieser Tiere sind.
 Parallel zur Verkleinerung der Grundstücksgrösse wird ihre Ausgestaltung immer uniformer: kurz gemähter Rasen bis zur Grundstücksgrenze; exotische Hecken, die einzig als Sichtschutz gegenüber den Nachbarn gewählt werden; Beete mit nicht einheimischen Pflanzen, die der Fortpflanzung der Schmetterlinge hinderlich sind und die viel zu wenig Früchte hervorbringen, um andere Tiere zu ernähren; allzu perfekt geschnittene Bäume, die keinen Schutz mehr bieten; nächtliche Beleuchtung des gesamten Terrains; übermässiger Einsatz von Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Rasen, Steinplatten und Rosenstöcken. Unter solchen Umständen finden Vögel und andere Kleintiere, die unsere Gärten besuchen, keine Orte mehr, an denen sie sich verstecken können. Sie finden weder Nistmaterial noch Insekten oder Beeren, ja, nicht einmal mehr Nachtruhe.
Parallel zur Verkleinerung der Grundstücksgrösse wird ihre Ausgestaltung immer uniformer: kurz gemähter Rasen bis zur Grundstücksgrenze; exotische Hecken, die einzig als Sichtschutz gegenüber den Nachbarn gewählt werden; Beete mit nicht einheimischen Pflanzen, die der Fortpflanzung der Schmetterlinge hinderlich sind und die viel zu wenig Früchte hervorbringen, um andere Tiere zu ernähren; allzu perfekt geschnittene Bäume, die keinen Schutz mehr bieten; nächtliche Beleuchtung des gesamten Terrains; übermässiger Einsatz von Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Rasen, Steinplatten und Rosenstöcken. Unter solchen Umständen finden Vögel und andere Kleintiere, die unsere Gärten besuchen, keine Orte mehr, an denen sie sich verstecken können. Sie finden weder Nistmaterial noch Insekten oder Beeren, ja, nicht einmal mehr Nachtruhe.
Was ist die Garten-Charta – und was ist sie nicht
 Die Garten-Charta ist ein Dokument, das zehn einfache und wirksame Massnahmen erklärt, welche die Artenvielfalt im Garten begünstigen. Es handelt sich nicht um eine Auflistung von Anforderungen, die man erfüllen muss, um ein Label zu erhalten, das anschliessend kontrolliert wird. Die Garten-Charta ist auch kein juristisches Dokument: Mit ihrer Unterzeichnung verpflichtet man sich moralisch, ihren Prinzipien zu folgen. Dieses persönliche Engagement kann mit dem Emblem am eigenen Garten für andere sichtbar gemacht werden.
Die Garten-Charta ist ein Dokument, das zehn einfache und wirksame Massnahmen erklärt, welche die Artenvielfalt im Garten begünstigen. Es handelt sich nicht um eine Auflistung von Anforderungen, die man erfüllen muss, um ein Label zu erhalten, das anschliessend kontrolliert wird. Die Garten-Charta ist auch kein juristisches Dokument: Mit ihrer Unterzeichnung verpflichtet man sich moralisch, ihren Prinzipien zu folgen. Dieses persönliche Engagement kann mit dem Emblem am eigenen Garten für andere sichtbar gemacht werden.
 Die Charta lässt sich auf jedem Terrain anwenden – egal ob gross oder klein und unabhängig von bereits bestehender oder neuer Bepflanzung. Auch ein Garten, der nur aus einer Kirschlorbeerhecke, einem kurz geschnittenen Rasen und exotischen Rhododendren besteht, kann ohne grossen Aufwand naturfreundlicher gestaltet werden: zum Beispiel mit dem Verzicht auf Pestizide, mit nicht ganz so kurz gemähtem Gras, mit einer kleinen Durchgangsöffnung im Gartenzaun und mit einer Aussenbeleuchtung, die abgeschaltet wird, wenn sie nicht benötigt wird. Ergibt sich die Gelegenheit neue Büsche zu setzen, sind einheimische Wildpflanzen eine gute Entscheidung.
Die Charta lässt sich auf jedem Terrain anwenden – egal ob gross oder klein und unabhängig von bereits bestehender oder neuer Bepflanzung. Auch ein Garten, der nur aus einer Kirschlorbeerhecke, einem kurz geschnittenen Rasen und exotischen Rhododendren besteht, kann ohne grossen Aufwand naturfreundlicher gestaltet werden: zum Beispiel mit dem Verzicht auf Pestizide, mit nicht ganz so kurz gemähtem Gras, mit einer kleinen Durchgangsöffnung im Gartenzaun und mit einer Aussenbeleuchtung, die abgeschaltet wird, wenn sie nicht benötigt wird. Ergibt sich die Gelegenheit neue Büsche zu setzen, sind einheimische Wildpflanzen eine gute Entscheidung.
Die Garten-Charta herunterladen
Wie kann man der Garten-Charta beitreten?
Sie können der Garten-Charta entweder als Einzelperson oder als Vertreter:in einer Körperschaft (Gemeinde, Unternehmen, Verein...) beitreten. Das Formular kann entweder online oder von Hand ausgefüllt werden (PDF-Format – z. B. für eine Verteilung an einem Stand). In jedem Fall muss es unterschrieben und per Post (nach dem Ausdrucken) oder per E-Mail eingesendet werden.
Mit demselben Formular können Sie auch ein Emblem bestellen, das sichtbar ausgehängt werden kann, um Ihr Engagement zu zeigen und die Charta in Ihrem Quartier zu fördern. Falls Sie keines der vorgeschlagenen Embleme wünschen, können Sie auch selbst eines bei einer Gravurwerkstatt anfertigen lassen, indem Sie ihr die Datei mit dem Logo der Garten-Charta übergeben.
 Wie die Garten-Charta bekannt machen und wie sie umsetzen?
Wie die Garten-Charta bekannt machen und wie sie umsetzen?
Die Garten-Charta kann von frei im Internet heruntergeladen werden. Alle, die ihre Praktiken befolgen möchten, können das Emblem gut sichtbar an ihrem Garten anbringen. Aber es wäre gut, wenn dieses Engagement nicht nur das Anliegen von Einzelnen bliebe. Denn eines der Ziele der Charta ist, die Gärten untereinander zu vernetzen, da die kleinen Wildtiere in der Regel einen grösseren Lebensraum benötigen, als sie ein einziges Gartengrundstück bieten kann. Im Idealfall wird die Garten-Charta deshalb von einem lokalen Organ verwaltet (Gemeinde, Quartierverein oder Anwohnergruppe).
Ausserdem hat eine Gemeinde meist bessere Möglichkeiten als eine einzelne Person, die Garten-Charta grossräumig bekannt zu machen. Sie kann zum Beispiel die Garten-Charta ihren offiziellen Schreiben beilegen und so bei einer Veränderung der Gartengestaltung oder bei einem Besitzerwechsel einer Parzelle die neuen Eigentümer auf sie aufmerksam machen.
Verwaltung durch eine Gemeinde oder eine Anwohnergruppe
Das Emblem der Garten-Charta
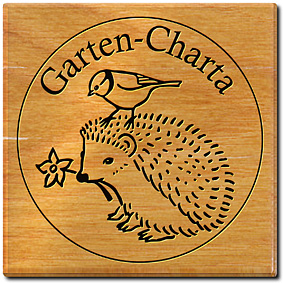 Das Logo, die Bilder und die Texte der Garten-Charta sind Eigentum der enegie-environnement.ch, die Informationsplattform der Kantonalen Dienststellen für Energie und Umweltschutz. Ihre Verwendung, die der Förderung und Verbreitung der Garten-Charta vorbehalten ist, wird von energie-environnement kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Logo, die Bilder und die Texte der Garten-Charta sind Eigentum der enegie-environnement.ch, die Informationsplattform der Kantonalen Dienststellen für Energie und Umweltschutz. Ihre Verwendung, die der Förderung und Verbreitung der Garten-Charta vorbehalten ist, wird von energie-environnement kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Logo der Garten-Charta (eps 850 Ko) kann im Internet in einer bei Schilderherstellern gebräuchlichen Grösse frei heruntergeladen werden. Das ist praktisch für Gemeinden oder Vereine, die es benutzen und vielleicht auch ihren Namen hinzufügen möchten, denn so erfahren interessierte Passanten, an wen sie sich wenden können (siehe Abbildung links).
Für Kollektive besteht die Möglichkeit, eine Serie von Emblemen oder Sonderanfertigungen wie zum Beispiel grössere und besser sichtbare Embleme für ein Schulgelände oder einen öffentlichen Park in einer Werkstätte für Behinderte herstellen zu lassen.
Bei individuellen Beitritten erfolgt die Postzustellung des Emblems (aus Lärchenholz, Akryl oder Aluminium) via der Stiftung FOVAHM (Walliser Stiftung für Menschen mit geistiger Behinderung).
Embleme der Garten-Charta
Entstehungsgeschichte
Die Artenvielfalt in privaten Gärten fördern ist nur ein Teil der Anliegen, für die sich die Informationsplattform energie-environnement stark macht. Bereits in der Vergangenheit hat sie zwei Aufrufe an die Öffentlichkeit gerichtet, die beide erfolgreich verlaufen sind: Im Jahr 2000 lancierte sie in Zusammenarbeit mit der Naturzeitschrift "La Salamandre" und dem Schweizer Zentrum für Kartografie der Fauna (CSCF) eine Inventarisierung der Glühwürmchen, und 2007 führte sie in Zusammenarbeit mit dem Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF) eine Untersuchung über Wildorchideen in Gärten durch.
 Konkrete Formen nahm die Idee einer Garten-Charta dank der begeisterten Aufnahme bei der "Association des intérêts de Conches" (Gemeinde Chêne-Bougeries, Genf) an, die im Mai 2007 beschloss ein Pilot-Versuch durchzuführen, das die Kontakte zwischen den Nachbarn fördert und gleichzeitig die Naturnähe des Quartiers erhält – denn hier gibt es die meisten Brutvögel des Kantons Genf. Die Garten-Charta und ihr Emblem sind dank der Unterstützung und der Anregungen der Gemeinde Chêne-Bougeries sowie der Fachstelle "Natur und Landschaft" des Kantons Genf entstanden. Ein grosser Dank gebührt selbstverständlich auch den weiteren zahlreichen Personen, die bei ihrer Gestaltung und Entwicklung mitgeholfen haben.
Konkrete Formen nahm die Idee einer Garten-Charta dank der begeisterten Aufnahme bei der "Association des intérêts de Conches" (Gemeinde Chêne-Bougeries, Genf) an, die im Mai 2007 beschloss ein Pilot-Versuch durchzuführen, das die Kontakte zwischen den Nachbarn fördert und gleichzeitig die Naturnähe des Quartiers erhält – denn hier gibt es die meisten Brutvögel des Kantons Genf. Die Garten-Charta und ihr Emblem sind dank der Unterstützung und der Anregungen der Gemeinde Chêne-Bougeries sowie der Fachstelle "Natur und Landschaft" des Kantons Genf entstanden. Ein grosser Dank gebührt selbstverständlich auch den weiteren zahlreichen Personen, die bei ihrer Gestaltung und Entwicklung mitgeholfen haben.
Auskünfte
- energie-umwelt.ch
Garten-Charta
Rue du Tunnel 7
CH-1227 Carouge
Tel. +41 22 809 40 59
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
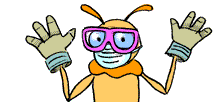
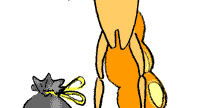




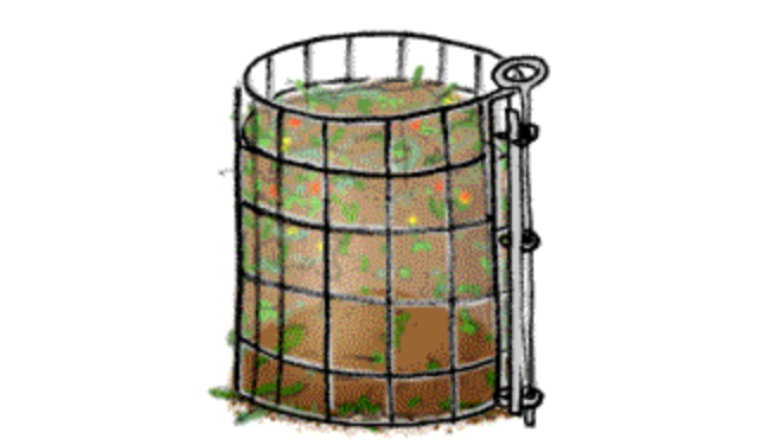
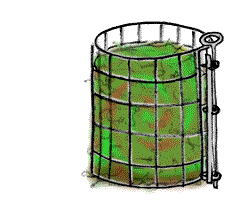

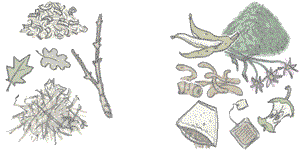
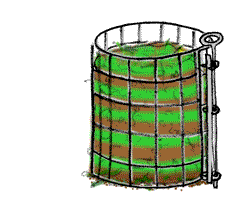
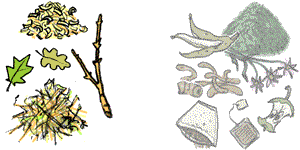
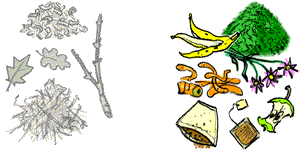
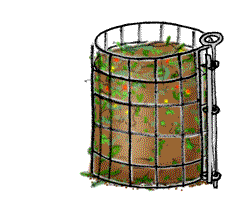
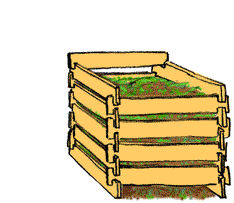
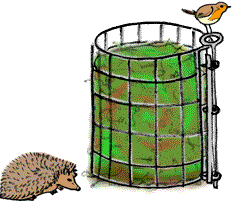
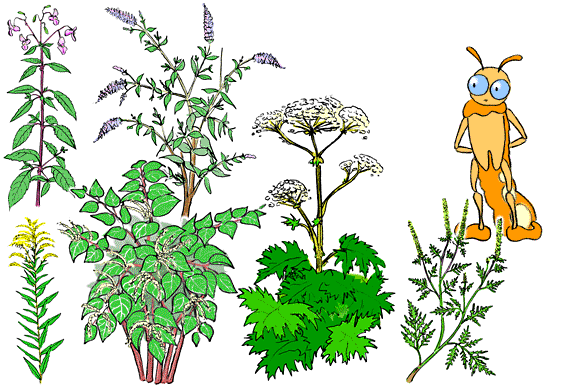

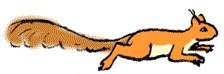 Lange Zeit war es für die sympathischen Besucher unserer Gärten wie Igel, Eichhörnchen, Vögel oder Schmetterlinge ein Leichtes, im Umkreis der Wohngebiete Nahrung und auch Plätze zu finden, wo sie ihren Nachwuchs aufziehen oder den Winter verbringen konnten. Aber die für die kleine Tierwelt günstigen Orte werden immer seltener, unter anderem weil die naturbelassenen Plätze zwischen den bewohnten und landwirtschaftlich genutzten Zonen unter dem Druck der Verstädterung seltener werden. Hinzu kommt, dass grössere Landflächen in kleinere, voneinander abgetrennte Parzellen aufgeteilt werden. Mit der Parzellierung verschwinden aber wilde Hecken, alte Bäumbestände, weniger oft gemähte Wiesen sowie Haufen aus Steinen und Ästen, die so wichtig für das Überleben und die Fortpflanzung dieser Tiere sind.
Lange Zeit war es für die sympathischen Besucher unserer Gärten wie Igel, Eichhörnchen, Vögel oder Schmetterlinge ein Leichtes, im Umkreis der Wohngebiete Nahrung und auch Plätze zu finden, wo sie ihren Nachwuchs aufziehen oder den Winter verbringen konnten. Aber die für die kleine Tierwelt günstigen Orte werden immer seltener, unter anderem weil die naturbelassenen Plätze zwischen den bewohnten und landwirtschaftlich genutzten Zonen unter dem Druck der Verstädterung seltener werden. Hinzu kommt, dass grössere Landflächen in kleinere, voneinander abgetrennte Parzellen aufgeteilt werden. Mit der Parzellierung verschwinden aber wilde Hecken, alte Bäumbestände, weniger oft gemähte Wiesen sowie Haufen aus Steinen und Ästen, die so wichtig für das Überleben und die Fortpflanzung dieser Tiere sind. Parallel zur Verkleinerung der Grundstücksgrösse wird ihre Ausgestaltung immer uniformer: kurz gemähter Rasen bis zur Grundstücksgrenze; exotische Hecken, die einzig als Sichtschutz gegenüber den Nachbarn gewählt werden; Beete mit nicht einheimischen Pflanzen, die der Fortpflanzung der Schmetterlinge hinderlich sind und die viel zu wenig Früchte hervorbringen, um andere Tiere zu ernähren; allzu perfekt geschnittene Bäume, die keinen Schutz mehr bieten; nächtliche Beleuchtung des gesamten Terrains; übermässiger Einsatz von Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Rasen, Steinplatten und Rosenstöcken. Unter solchen Umständen finden Vögel und andere Kleintiere, die unsere Gärten besuchen, keine Orte mehr, an denen sie sich verstecken können. Sie finden weder Nistmaterial noch Insekten oder Beeren, ja, nicht einmal mehr Nachtruhe.
Parallel zur Verkleinerung der Grundstücksgrösse wird ihre Ausgestaltung immer uniformer: kurz gemähter Rasen bis zur Grundstücksgrenze; exotische Hecken, die einzig als Sichtschutz gegenüber den Nachbarn gewählt werden; Beete mit nicht einheimischen Pflanzen, die der Fortpflanzung der Schmetterlinge hinderlich sind und die viel zu wenig Früchte hervorbringen, um andere Tiere zu ernähren; allzu perfekt geschnittene Bäume, die keinen Schutz mehr bieten; nächtliche Beleuchtung des gesamten Terrains; übermässiger Einsatz von Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Rasen, Steinplatten und Rosenstöcken. Unter solchen Umständen finden Vögel und andere Kleintiere, die unsere Gärten besuchen, keine Orte mehr, an denen sie sich verstecken können. Sie finden weder Nistmaterial noch Insekten oder Beeren, ja, nicht einmal mehr Nachtruhe. Die Garten-Charta ist ein Dokument, das zehn einfache und wirksame Massnahmen erklärt, welche die Artenvielfalt im Garten begünstigen. Es handelt sich nicht um eine Auflistung von Anforderungen, die man erfüllen muss, um ein Label zu erhalten, das anschliessend kontrolliert wird. Die Garten-Charta ist auch kein juristisches Dokument: Mit ihrer Unterzeichnung verpflichtet man sich moralisch, ihren Prinzipien zu folgen. Dieses persönliche Engagement kann mit dem Emblem am eigenen Garten für andere sichtbar gemacht werden.
Die Garten-Charta ist ein Dokument, das zehn einfache und wirksame Massnahmen erklärt, welche die Artenvielfalt im Garten begünstigen. Es handelt sich nicht um eine Auflistung von Anforderungen, die man erfüllen muss, um ein Label zu erhalten, das anschliessend kontrolliert wird. Die Garten-Charta ist auch kein juristisches Dokument: Mit ihrer Unterzeichnung verpflichtet man sich moralisch, ihren Prinzipien zu folgen. Dieses persönliche Engagement kann mit dem Emblem am eigenen Garten für andere sichtbar gemacht werden. Die Charta lässt sich auf jedem Terrain anwenden – egal ob gross oder klein und unabhängig von bereits bestehender oder neuer Bepflanzung. Auch ein Garten, der nur aus einer Kirschlorbeerhecke, einem kurz geschnittenen Rasen und exotischen Rhododendren besteht, kann ohne grossen Aufwand naturfreundlicher gestaltet werden: zum Beispiel mit dem Verzicht auf Pestizide, mit nicht ganz so kurz gemähtem Gras, mit einer kleinen Durchgangsöffnung im Gartenzaun und mit einer Aussenbeleuchtung, die abgeschaltet wird, wenn sie nicht benötigt wird. Ergibt sich die Gelegenheit neue Büsche zu setzen, sind einheimische Wildpflanzen eine gute Entscheidung.
Die Charta lässt sich auf jedem Terrain anwenden – egal ob gross oder klein und unabhängig von bereits bestehender oder neuer Bepflanzung. Auch ein Garten, der nur aus einer Kirschlorbeerhecke, einem kurz geschnittenen Rasen und exotischen Rhododendren besteht, kann ohne grossen Aufwand naturfreundlicher gestaltet werden: zum Beispiel mit dem Verzicht auf Pestizide, mit nicht ganz so kurz gemähtem Gras, mit einer kleinen Durchgangsöffnung im Gartenzaun und mit einer Aussenbeleuchtung, die abgeschaltet wird, wenn sie nicht benötigt wird. Ergibt sich die Gelegenheit neue Büsche zu setzen, sind einheimische Wildpflanzen eine gute Entscheidung. Wie die Garten-Charta bekannt machen und wie sie umsetzen?
Wie die Garten-Charta bekannt machen und wie sie umsetzen?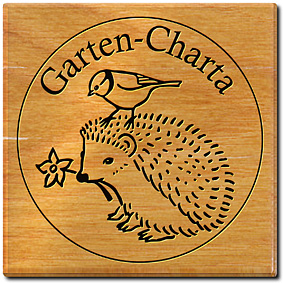 Das Logo, die Bilder und die Texte der Garten-Charta sind Eigentum der enegie-environnement.ch, die Informationsplattform der Kantonalen Dienststellen für Energie und Umweltschutz. Ihre Verwendung, die der Förderung und Verbreitung der Garten-Charta vorbehalten ist, wird von energie-environnement kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Logo, die Bilder und die Texte der Garten-Charta sind Eigentum der enegie-environnement.ch, die Informationsplattform der Kantonalen Dienststellen für Energie und Umweltschutz. Ihre Verwendung, die der Förderung und Verbreitung der Garten-Charta vorbehalten ist, wird von energie-environnement kostenlos zur Verfügung gestellt. Konkrete Formen nahm die Idee einer Garten-Charta dank der begeisterten Aufnahme bei der "Association des intérêts de Conches" (Gemeinde Chêne-Bougeries, Genf) an, die im Mai 2007 beschloss ein Pilot-Versuch durchzuführen, das die Kontakte zwischen den Nachbarn fördert und gleichzeitig die Naturnähe des Quartiers erhält – denn hier gibt es die meisten Brutvögel des Kantons Genf. Die Garten-Charta und ihr Emblem sind dank der Unterstützung und der Anregungen der Gemeinde Chêne-Bougeries sowie der Fachstelle "Natur und Landschaft" des Kantons Genf entstanden. Ein grosser Dank gebührt selbstverständlich auch den weiteren zahlreichen Personen, die bei ihrer Gestaltung und Entwicklung mitgeholfen haben.
Konkrete Formen nahm die Idee einer Garten-Charta dank der begeisterten Aufnahme bei der "Association des intérêts de Conches" (Gemeinde Chêne-Bougeries, Genf) an, die im Mai 2007 beschloss ein Pilot-Versuch durchzuführen, das die Kontakte zwischen den Nachbarn fördert und gleichzeitig die Naturnähe des Quartiers erhält – denn hier gibt es die meisten Brutvögel des Kantons Genf. Die Garten-Charta und ihr Emblem sind dank der Unterstützung und der Anregungen der Gemeinde Chêne-Bougeries sowie der Fachstelle "Natur und Landschaft" des Kantons Genf entstanden. Ein grosser Dank gebührt selbstverständlich auch den weiteren zahlreichen Personen, die bei ihrer Gestaltung und Entwicklung mitgeholfen haben.